PEKING
Ankunft in Peking – erste Eindrücke
In Peking angekommen verlief alles zunächst protokollarisch. Beim
Aussteigen musste der Chef vornweg gehen, dahinter ich, dann der Offizielle
und der Verwaltungsdirektor.
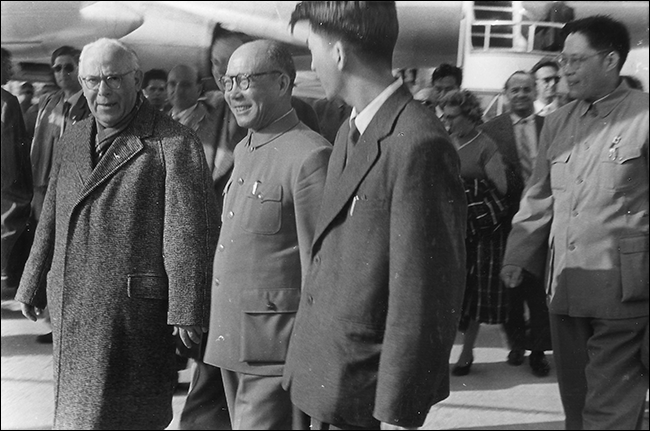
Links: Prof. Heinz Bongartz, dahinter ich
Mitte: Ein chinesischer Funktionär mit Dolmetscher
Wer uns empfing ist mir nicht mehr geläufig. Wir wussten nicht ob
es ein Minister war oder ein hoher Kulturfunktionär.
Uns bot sich ein Bild das wir nicht vermutet hatten. Auf dem Flugfeld
standen Hunderte von jungen Chinesen, bunt gekleidet, mit Blumensträußen
in der Hand. Dass dies gut organisiert schien war sofort erkennbar. Trotzdem,
eine sehr freundliche und herzliche Begrüßung von allen chinesischen
Freunden.
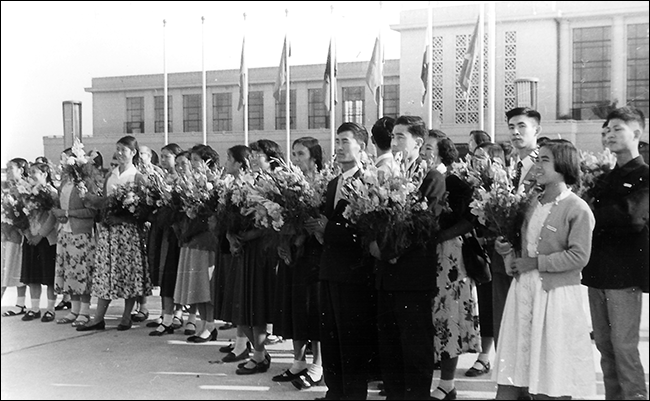
Junge Chinesen als Empfangskomitee
Vor dem Flughafengebäude standen Busse und zwei PKW-Wolga.
Im ersten saß der Professor mit dem deutschen und chinesischen Funktionär.
Im Zweiten sollte ich Platz nehmen und der Verwaltungsdirektor. Die Kollegen
stiegen in die Busse und der Konvoi fuhr zum Hotel. Alle schauten natürlich
neugierig auf die Menschen, was sich auf den Straßen alles bewegt
und was sich da abspielt. Eindrücke, die ich noch genauer schildern
werde.
Am Hotel angekommen, sahen wir ein enorm großes Portal. Davor wundervoll
blühende Sträucher, meist Magnolien, aber auch andere uns unbekannte
Blütengewächse. Diese Blütenpracht im September für
uns ungewöhnlich. Die Außentemperatur lag bei 25°C. Das
gesamte Hotel ein riesiger Komplex.
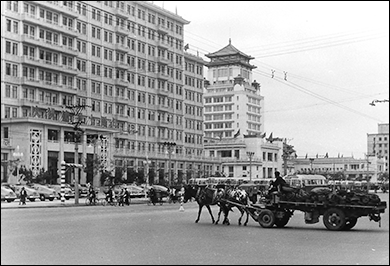
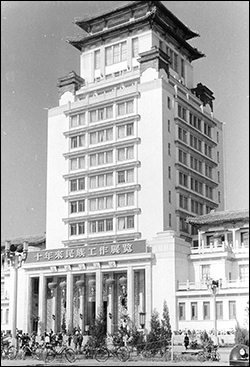
Der Gesamtkomplex unseres Hotels und das Eingangsportal
Vom Klima ausgehend, liegt Peking relativ weniger südlich, trotzdem
empfing uns eine sommerliche Wärme, die wohltuend wirkte. In der
Empfangshalle fanden wir jede Menge kleine Kioske mit allerhand Angeboten.
Die Kollegen stürzten sich beiläufig auf diese, nicht nur um
sich zu informieren, sondern neugierig schauend, was alles angeboten wird.
In der Zwischenzeit verhandelten der Professor und der Verwaltungsdirektor
mit den chinesischen Verantwortlichen über die Reise und eine Art
Tagesrhythmus. Die chinesischen Freunde meinten, dass wir nur 24 Konzerte
geben sollten, weil sie uns Zeit lassen wollten um das Land, die Sehenswürdigkeiten
und die Menschen kennen zu lernen. Der Tagesrhythmus wurde festgelegt,
die Tagegelder verhandelt und ausgeteilt, die Zimmerverteilung vorgenommen
usw. Bei solchen Reisen führte die Philharmonie immer eine Liste
mit, wer mit wem zusammen ein Zimmer bezieht. Für uns Leitungsmitglieder
und die Solisten gab es Einzelzimmer.
Mein Dolmetscher – mein Begleiter durch ein fremdes Land
Als alles geregelt war (die Tagegelder nebenbei bemerkt sehr üppig,
sie ergaben die Größenordnung eines monatlichen Arztgehaltes,
wie mir mein Dolmetscher später berichtete) wollte ich auf mein Zimmer
gehen, als plötzlich ein für mich vermeintlich jüngerer
Chinese an mich herantrat und sich als Dolmetscher vorstellte, der nur
für mich eingesetzt wurde.
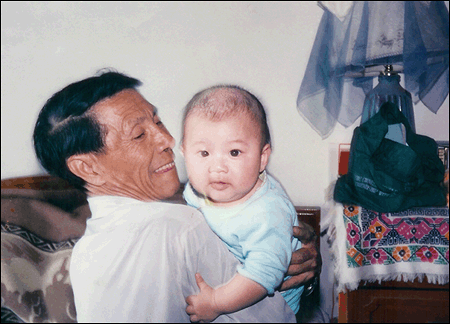
Bei einem Besuch in Suhl im April 1989 übergeben:
Jing mit seinem Enkel, ein stolzer Opa!
Überrascht darüber dass ich einen eigenen Dolmetscher bekam,
fragte ich ihn nach seinem Namen. Er sagte zu mir, er heiße: Jing
Xion-hai. Bei persönlichen Vorstellungen kann man meist nur phonetisch
aufnehmen was gesprochen wird und so musste ich nochmal nachfragen. Es
erschien schwierig den Namen richtig zu erfassen und auszusprechen, so
dass ich ab da nur "Djin" zu ihm sagte. Für mich war Djin
einer der liebenswertesten Menschen! Intelligent, höflich, perfekt
deutsch sprechend, immer besorgt um mich und ständig anwesend wenn
ich etwas unternehmen wollte, oder wenn er etwas übersetzen musste.
Bei mir kam nie das Gefühl auf er sei mein "Bewacher",
sondern er entwickelte sich in den sechs Wochen zu einem guten Freund.
Wie ich nach ein paar Tagen des Zusammenseins erfuhr war er Sprach- und
Literaturwissenschaftler. Er erzählte mir u.a. dass er den 1. Teil
von Goethes "Faust" ins chinesische übersetzt hätte.
Das sagt alles über seine Qualitäten!
Mit ihm erlebte ich die Reise in einer wundervollen Harmonie und mit vielen
interessanten Diskussionen, bis hin zu Fragen über Deutschland, die
deutsche und europäische Kultur. Er wollte alles erfahren und wissen,
so dass ich mein ganzes Schulwissen hervorholen musste um ihm präzise
Antworten zu geben. Oftmals sehr anstrengend, wiederum im Austausch sehr
erquicklich, denn gleichermaßen erfuhr ich vieles intimes was ansonsten
ein Ausländer nicht erfahren würde.
Hier muss ich einflechten, dass die Chinesen selber unterschiedlich schreiben,
wahrscheinlich durch die Schriftzeichen gegeben, aber auch durch das seit
der Kolonialisierung eingebürgerte "Pidgin-Englisch". Z.B.
las ich am Hauptbahnhof in Peking diesen Ort nachfolgend geschrieben:
"Beijing".
Beginn des Alltages - Speisen und Getränke
Djin begleitete mich auf mein Zimmer. Als ich in das Zimmer eintrat und
nach meinem Gepäck fragte, stellte ich fest dass mein Koffer und
meine Fracktasche bereits exakt an Ort und Stelle standen. Während
der gesamten Reise kam es mir vor, als wären Heinzelmännchen
unterwegs die mir alles abnehmen. Ich brauchte mich weder um mein Gepäck
noch um das persönlich organisatorische zu kümmern
Nach dem sich alle eingerichtet hatten wurden wir zum Mittagstisch gebeten.
Genauer gesagt, zu einem chinesischen Festbankett.
Traditionell setzte man uns in jedem Ort, bei der Ankunft und beim Verlassen,
immer ein original chinesisches Menü vor. Uns stand am Tag der Ankunft
ein achtzehngängiges Menü bevor, mit einem unglaublichen Angebot:
reichhaltig, vielfältig, buntfarbig geschmückt und schmackhaft
obendrein. Interessant dabei dass die Suppe – bei uns als Vorgericht
– zum Abschluss, quasi als Höhepunkt serviert wurde, danach
nur noch kleine Süßigkeiten.
Und ---- das alles mit Essstäbchen!!!
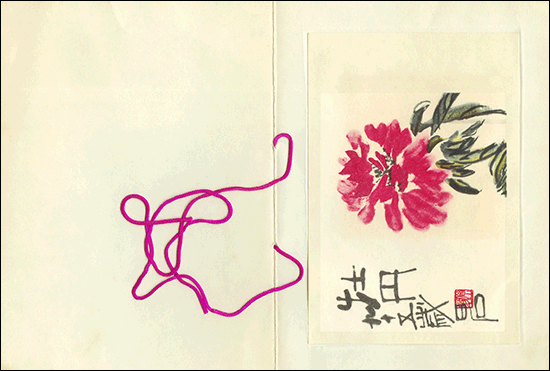
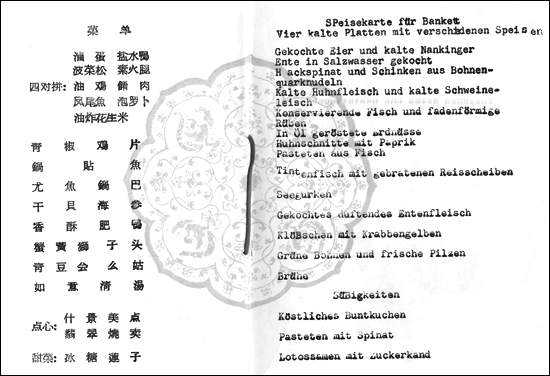
Speisenkarte
Ich ließ mir von Djin genau zeigen wie man die Stäbchen halten
musste, lernte das relativ schnell und konnte damit ganz gut umgehen.
Dass diese Art zu speisen viel Kurioses und Lustiges mit sich brachte,
ist beiläufig verständlich.
Ein köstliches Bild gab es von Prof. Bongartz: er langt mit der rechten
Hand aus einem Berg von Erdnüssen – die bei jeder Gelegenheit
auf den Tischen serviert wurden – mit den Essstäbchen eine
heraus, aber mit der linken führt er sich eine Erdnuss zum Mund.
Eine nette Erinnerung über die "humorvolle" Seite chinesisch
zu essen!
Wenn ich an das Essen denke, welches wir in China geboten bekamen, muss
ich erwähnen, dass ich mit 94 kg Nacktgewicht wegfuhr und mit 104
kg wiederkam! Außer den Begrüßungsmenüs versorgte
man uns allerdings auf der gesamten Reise durchweg europäisch. In
den ersten Tagen gab es zum Frühstück einmal kalte, scharf gewürzte
Pekingente, ca. 3x2 cm große Stücke. Beim Kosten dieser Delikatesse
blieb mir das erste Mal regelrecht die Luft weg. Eine für uns ungewohnte,
aber schmackhafte Schärfe, die durch einlegen und einstreichen mit
Gewürzen erreicht wird. Flache Stücken, die so gut wie nicht
fetthaltig waren.
Natürlich aßen wir auch zu den Hauptmahlzeiten irgendwann warme
Pekingente. Von Djin ließ ich mir erklären, wie diese Speise
hergestellt wird. Er sagte mir, dass die Enten zugenäht werden, mit
Luft aufgepumpt, tagelang am Haken hängen. Mit Gewürzen bestrichen
erhalten sie dann beim Braten diesen wundervollen Geschmack. Ein erster
Eindruck einer Speisekultur, die wir in Deutschland nicht kannten.
Zu allem bekamen wir Bier zum Trinken. Die Chinesen sind selber gute Biertrinker
und freuen sich maßlos, wenn jemand mit ihnen trinkt. Zu unserem
Erstaunen gab es "Radeberger Pilsner"??? Wir erfuhren in China,
dass in den 50ger Jahren die Radeberger ihnen eine Brauerei gebaut hatten.
Dazu wurden Braumeister aus Radeberg nach China entsandt, um ihnen das
Brauen beizubringen. Ich bin sicher, dass die Chinesen das sofort kopiert
und selber andere Brauereien bauten, denn bei dem Bierkonsum, den sie
selber benötigten, reicht eine Brauerei nicht aus. Quasi Dresdner
Bier in China? Wir fühlten uns wie zu Hause!
Ehrlich gesagt: wir kamen bei dem was man uns bot, aus dem Staunen nicht
heraus! Der erste Tag verlief wie im Traum.
Die ersten Sehenswürdigkeiten und Nationaloper
Alle wollten natürlich an den "Teng en man"
und in den Kaiserpalast, in die verbotene Stadt.
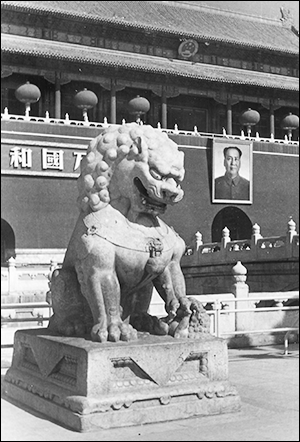 |
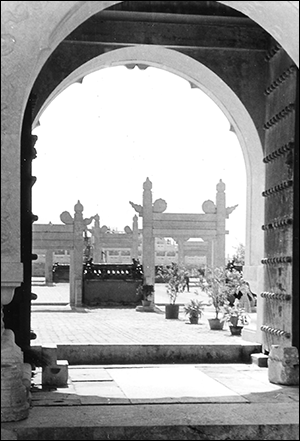 |
| Haupttor am "Teng en man" | Im
Palast (die Tore bedeuten: "Bring Glück herein") Man steigt immer über eine Schwelle |
Dies
alles lies sich nicht an einem Tag bewältigen, aber unser Aufenthalt
in Peking dauerte 8 - 10 Tage. Insgesamt gaben wir 6 Konzerte, darunter
der Abend mit chinesischer sinfonischer Musik.
Zum Begrüßungszeremoniell gehörte, dass man uns in jeder
Stadt eine Oper vorführte. Jeder der Distrikte oder Bezirke in China
hat seine eigene Bezeichnung für diese Opern. (Pekingoper, Nankingoper,
Tschungkingoper, usw.)
Wir erlebten also als erstes eine Peking-Oper. Vom Dolmetscher lies ich
mir erklären, was die Mimik und die Gesten bedeuten, denn wir konnten
uns darunter nichts vorstellen. Er sagte mir, dass man von Kind auf in
die Oper gehen müsste um die Mimik und die Gestik zu verstehen. Jede
kleine Fingerbewegung hätte eine Bedeutung, es sei wie eine Sprache,
nur wortlos und um sie verstehen zu können muss man diese Zeichensprache
erlernen. Für uns schien das alles gleichförmig zu sein und
nicht voneinander unterscheidbar. Die Musik, typisch chinesisch, hörte
sich so fremd und bizarr an, dass man die Klänge nicht voneinander
unterscheiden konnte, es schien immer dasselbe zu sein. Sehr gewöhnungsbedürftig.
Auf dem nachfolgenden Bild sieht man u.a. einige Instrumente die zum Musizieren
von Opern verwendet werden.
 |
 |
| Volksmusik
zur Begrüßung (rechter Musiker mit einer Suona, Oboe) |
|
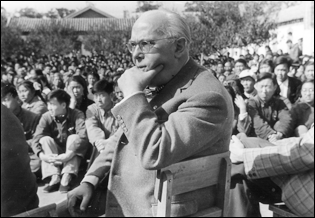 |
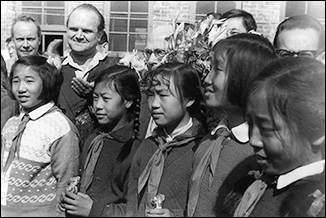 |
| Prof. Bongartz interessiert zuhörend | Links KV Butowski, rechts daneben Verwaltungsdirektor Oskar Sick |
Mit
dieser Suona (phonetisch Soona) genannten Oboe verbindet sich eine nette
Story. Unser Solooboer Kammervirtuos Heinz Butowski lies sich natürlich
das Instrument genau erklären. Mit wenigen Löchern ausgestattet,
die mit den Fingern abgedeckt werden, kann man trotz alledem chromatische
Töne erzeugen. Das verwunderte alle Musiker, denn keiner konnte sich
das vorstellen. Das Instrument klang schrill, fast quakend und bizarr.
Als die Musiker den Namen des Instrumentes hörten, wurde Butowski
natürlich sofort gefrotzelt. Bekanntlich gibt der Solo-Oboer beim
Einstimmen des Orchesters den Kammerton: 'a' an, ab da hieß es nur
noch: "Heinz, gib mal e' Sona-Solo!"
Neben dem Ernst solcher Konzerttourneen, tragen immer humorvolle Szenen
zum Ergötzen bei, was für die Erinnerung nützlich ist.
Die Konzerte - Chinas Konzertsäle
Wir wollten den Konzertsaal kennen lernen, die Akustik ausprobieren, die
Bühnenverhältnisse anschauen. Alles notwendige Voraussetzungen
die ein Reiseorchester routinemäßig durchführen muss.
Djin fuhr mit mir - mit dem schon genannten Wolga der zu meiner Verfügung
stand – zum Volkskongresssaal.

Volkskongresssaal in Peking (10 000 Sitzplätze)
Im Saal angekommen war ich nicht nur von der Größe sondern
auch vom Ansehen her überrascht und überwältigt. Meine
erste Frage an Djin: "Wie viele Besucher gehen hier rein?" Er
sagte ganz schlicht: "Zehntausend".
Das konnte ich mir kaum vorstellen. Die zweite Überraschung folgte:
die chinesischen Techniker schalteten langsam hochziehend die Deckenbeleuchtung
ein. Mir bot sich ein Bild welches wie die aufgehende Sonne des Ostens
auf mich einwirkte. Ein unbeschreiblich schöner Anblick. Meiner Schätzung
nach müssten es an die zweitausend in die Decke eingelassene Tiefstrahler
gewesen sein die eingeschaltet wurden.
Ein weiteres unglaubliches Vorkommnis: Die Instrumenten- und Frackkoffer,
das Instrumentarium standen bereit und die "Mäxe", aber
auch die Kollegen, brauchten nur noch auszupacken. Alles hatten chinesische
Techniker, oder Hilfskräfte an Ort und Stelle transportiert und aufgebaut.
Es schien fast gespenstisch zu sein wie das funktionierte und wie das
organisiert war. Das Konzertprogramm hatten wir in Dresden einstudiert,
außerdem gehörten die Beethoven-Sinfonien zu den Repertoirestücken,
so dass mehr oder weniger nur angespielt werden musste. Professor Bongartz
übernahm den ersten Teil der Probe, fragte mich wie es klingt. Der
Zuschauerraum mit Stoffen bedeckt, so als würde der Saal voll besetzt
sein. Als die ersten Töne des Orchesters erklangen glaubte ich, der
ich im Zuschauerraum saß, das kann nicht wahr sein. Ein Saal mit10
000 Zuhörern und diese herrliche Akustik. Es klang wie in einem Kirchenraum
die im Allgemeinen die beste Akustik besitzen. In jeder Entfernung des
Saales hörte man gleichwertig das Orchester. Bongartz wollte das
natürlich auch hören, so dass ich den 2.Teil der Probe übernahm.
Zufriedengestellt schauten alle begeistert in die Runde und erwarteten
mit Spannung wie das erste Konzert verlaufen wird und wie die Chinesen
dieses aufnehmen.
Das 1. Konzert am 7. Oktober 1959
Wie bereits gesagt, dirigierte selbstverständlich Prof. Heinz Bongartz
das erste Konzert mit der 5. Sinfonie von Beethoven und den anderen Werken.
Leider besitze ich keine Programme mehr von diesen Konzerten und erinnere
mich nicht was noch gespielt wurde.
Der Konzertabend kam. Für uns, die wir keinen Dienst hatten, war
eine extra Reihe im Saal reserviert. Ich meine es könnte die Reihe
gewesen sein, die nach dem Zwischengang liegt. Gleich wie, Djin führte
mich kurz vor Beginn in diese Reihe. Der Saal war bis auf den letzten
Platz gefüllt. Unvorstellbar was ich dann erlebte, ich wollte es
kaum glauben. In der hinter uns liegenden Reihe standen zwei Männer
und warteten darauf, mich zu begrüßen. Djin stellte mich den
Herren als Dirigenten der Philharmonie vor und danach stellte er die Würdenträger
vor:
"Der Genosse Ministerpräsident Tchou en Lai,
der Genosse Außenminister Chen Ji."
Zunächst war ich überrascht und leicht konsterniert. Dann entspann
sich ein Gespräch zwischen Tchou en Lai und mir. Bei diesem kurzen
Gespräch half mir meine schon gewonnenen Erfahrungen der ersten Spielzeit
in Dresden sich diplomatisch zu verhalten und ein Institut zu Repräsentieren!
Er sagte zu mir sinngemäß, aber äußerst respektvoll,
dass sie mit großem Interesse die Konzerte verfolgen werden und
sich freuen, die deutsche Kultur kennen zu lernen und dass dies der Völkerfreundschaft
dienen würde.
Ich erwiderte, dass wir uns sehr glücklich schätzen und sehr
dankbar sind für die Einladung und uns auf die Reise freuen, um die
chinesische Kultur und das Leben in China kennen zu lernen.
Dass solche Gespräche Höflichkeitszeremonien sind ist selbstverständlich
und üblich.
(Tschou en-Lai war nach Mao tse-tung der zweithöchste Revolutionsführer
bei dem Umbruch zu einem kommunistischen China und der wichtigste Funktionär
bei dem sog. "Langen Marsch" nach Nordchina, um Chiang Kai-shek
zu besiegen und zu stürzen.)
Nach dem Konzert nahmen sich die beiden höchsten Würdenträger
noch die Zeit mit Bongartz und mir, sowie Oskar Sick, dem Kulturfunktionär
und dem DDR-Botschafter bei einer Tasse Tee (grundsätzlich üblich
in China) weitere Gespräche zu führen.
Das Konzert war ein triumphaler Erfolg! Die Philharmonie mit Bongartz
wurde gefeiert – und das war nicht gestellt, oder pflichtgemäß
angeordnet – mit einem nicht enden wollenden Beifall. Jeder spürte,
dass die chinesischen Zuhörer fasziniert waren von dem Gehörten
und dass der Beifall spontan und von Herzen kam. In solchen Momenten spürt
man, dass Kunst und Kultur, vor allem aber die Musik eine internationale
Sprache ist, die jeder versteht und die jeder aufnehmen kann. Es gibt
nichts Gleichwertigeres, um die Menschen auf der gesamten Welt zu vereinen
und sie zusammen zu bringen!
Es müssen um die dreißig Blumenkörbe gewesen sein, die
von jungen Mädchen auf die Bühne zum Schluss gebracht wurden.
Beim Anblick der Mädchen schlugen die Herzen der Philharmoniker höher.
Es schien als wären es ausgesuchte sehr hübsche Mädchen.
Sie trugen lange farbige Röcke. An der Seite einen Schlitz der den
Oberschenkel beim Schreiten freilegte, so dass jedes Männerherz erweichen
könnte. Hier muss ich einflechten, dass man uns gewarnt hatte: wer
ein Mädchen oder eine Frau in China anfasst oder berührt, wird
sofort des Landes verwiesen. Dies nicht zu tun ist sicher einigen jüngeren
Philharmonikern beim Anblick der hübschen Mädchen nicht leicht
gefallen!!!
Der Beifall wollte nicht enden. Erst nach dem die Würdenträger
den Saal verließen verstummte er nach und nach.
Das 2. Konzert unter meiner Leitung
Mit Spannung bereitete ich mich auf den 2. Konzertabend vor. Die Erwartung,
wie die Werke aufgenommen werden macht jeden Dirigenten neugierig, denn
die Vorstellung wie diese das Publikum aufnimmt ist zunächst ungewiss.
Wenn ich mich richtig erinnere, dirigierte ich Beethovens Egmont-Ouvertüre,
danach das A-Dur Violinkonzert von Mozart, das der 1 Konzertmeister der
Philharmonie Ferdinand Baumbach spielte und die "Pastorale"
von Beethoven.
Beethoven hat man immer vorgeworfen die "Pastorale" sei eine
'Programm'-Sinfonie, weil er den einzelnen Sätzen Bezeichnungen gab.
So heißt der 1.Satz:
"Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande".
Der 2. Satz ist überschrieben mit: "Szene am Bach", der
3. Satz: "Lustiges Zusammensein der Landleute". Ohne Pause geht
es in den 4. Satz mit dem Titel: "Gewitter und Sturm" und die
Sinfonie endet mit dem "Hirtengesang - Frohe und dankbare Gefühle
nach dem Sturm".
Dass diese Bezeichnung jemals eine besondere Bedeutung erhalten sollte,
können sich europäische Konzertbesucher kaum vorstellen und
dass dies bei den chinesischen Zuhörern eine gewichtige Rolle spielte,
bekam ich erst bei den täglichen Gesprächen mit meinem Dolmetscher
zu spüren.
Als der letzte Akkord verklungen war, erlebte ich einen tosenden Beifall,
mehr noch als am 1. Abend nach der 5. von Beethoven. Kurz nach dem Konzert
fragte ich Djin warum an diesem Abend der Beifall noch größer
war als im ersten Konzert? Er sagte mir: den Zuhörern hätten
die "Szenen am Bach" sehr gefallen vor allem aber der "herannahende
Sturm und das Gewitter" und der "Hirtengesang". Die Bildhaftigkeit
der Musik sei sehr eingängig und verständlich. Mit dem "Klopfmotiv"
am Anfang der fünften von Beethoven könnten sie weniger anfangen
als mit den Bezeichnungen der "Pastorale". Wie sehr sich der
Unterschied abstrakten Denkens der asiatischen Menschen zu uns Europäern
unterscheidet, sollte sich bald herausstellen. Ich werde zu gegebener
Zeit dies noch erläutern.
In den darauffolgenden Tagen, in denen ich mich mit Djin immer mehr anfreundete
– er war, wie ich schon sagte, ein aufmerksamer, hochintelligenter
und sehr liebevoller Mensch – unterhielten wir uns natürlich
auch über viele persönliche Dinge.
In den ersten Tagen strebten alle Philharmoniker in die "Verbotene
Stadt", so auch ich. In diesem unglaublich wunderschönen Areal
sieht und erfährt man eigentlich alles über Chinesische Kultur,
über Bauweisen, über Religion, über Sitten und Gebräuche.
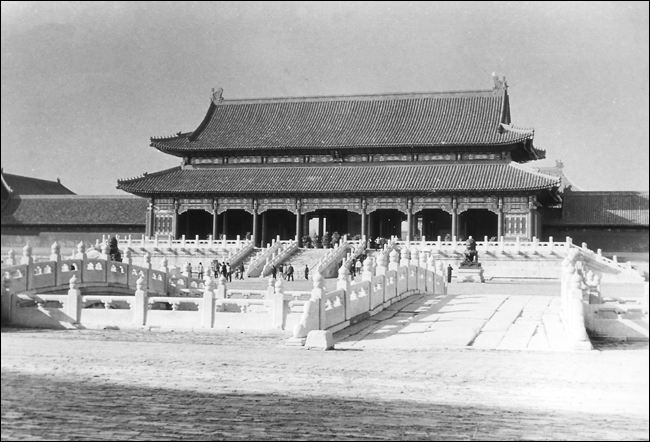
Der mittlere Kaiserpalast
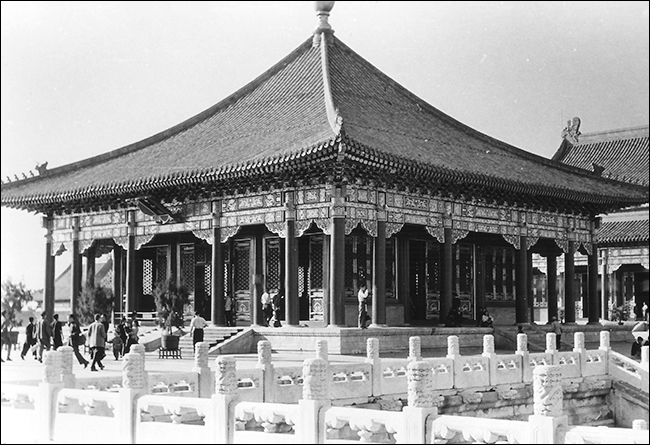
Der Tempel der Vollkommenen Harmonie
Mit diesem Tempel verbindet sich eine sehr lustige Story. Wie gesagt,
sah ich mir ebenfalls den Kaiserpalast an. Als ich mit Djin an den Tempel
der "Vollkommenen Harmonie" kam, standen dort einige Philharmoniker.
Da sie ohne Dolmetscher gekommen waren übersetzte Djin allen welche
Bedeutung dem Tempel inne liegt. Beim Übersetzen fiel ihm im Moment
das Wort "vollkommen" nicht ein, so dass er, nachdenklich und
einigem Zögern sagte, dies sei der Tempel der "viel Harmonie".
Musiker sind fast immer gewitzte und schlagfertige Typen, was zur Folge
hatte, dass ein Kollege schlagartig sagte: "Ach, das ist also der
Tempel der Philharmonie". Das gab ein herrliches Gelächter.
Djin selber musste mit lachen ob seines Versuches für das Wort "Vollkommen"
als äquivalent nur das "viel" gefunden zu haben. Der Spaß
machte natürlich seine Runde bei den Tischgesprächen.
Hier noch ein Detail der handwerklich prachtvollen und zierlichen Arbeiten,
wozu gesagt werden muss, dass alle Figuren eine Bedeutung besitzen.
Zu allem sei gesagt, dass 1959 die Bauweise und die Architektur, auch
der modernen Bauten in der Innenstadt noch traditionell gestaltet wurden,
nicht vergleichbar mit den heutigen, westlichen Baustilen, die mehr und
mehr in China um sich greifen und das originale China vergessen machen.

Dachgiebel des Tempels
Die Eindrücke der ersten Tage in Peking waren erdrückend und
ich musste aufpassen, dass mir die Konzentration auf das Eigentliche nicht
verloren geht.
Chinesische sinfonische Musik
Im vierten Konzert stand auf dem Programm der Abend mit chinesischer Musik.
Dieses Konzert - in meiner Erinnerung – eines der unglaublichsten
und glücklichsten Erlebnisse. Zunächst wollte ich wissen, wer
die Zuhörer sind in diesem Konzert? Djin sagte mir, man hätte
alle Musikstudenten, alle Professoren, andere Studenten und Interessierte
zu diesem speziellen Konzert eingeladen.
Im Nachhinein meine ich, dass auch die Kollegen der Pekinger Philharmonie
anwesend gewesen sein müssten. Auf dieses Orchester komme ich noch
in einem besonderen Zusammenhang zu sprechen.
(Was wir bis dato nicht wussten, dass China zwei Philharmonische Orchester
unterhielt, eines in Peking und das andere in Schanghai.)
Der Abend – in seiner gebotenen Eigenart – umwerfend und euphorisch!
Ein nicht enden wollender Beifall, trampeln (ungewöhnlich für
China) und begeisterte Zurufe. Mit diesem Konzert brachten wir zumindest
zum Ausdruck wie eine Musik klingen kann, selbst wenn sie für uns
ungewöhnlich ist, von Menschen komponiert die in einem fernen anderen
Erdteil leben. Trotzdem klangen die Werke irgendwie doch europäisch,
wozu man sagen muss, dass sinfonische Musik international sich nicht wesentlich
voneinander unterscheidet. Ich bin nicht mehr sicher ob ich die Komponisten
kennenlernte, denn es strömten sehr viele Menschen danach auf mich
ein.
Bei allen Konzerten gab es Blumenkörbe über Blumenkörbe.
Wir wussten schon nicht mehr was wir damit anfangen sollten. In einem
Ort zählte ich einmal 32 Körbe, vor dem Orchester aufgebaut,
auf der Bühne. Und das alles von sehr hübschen jungen Mädchen
hereingetragen. Unsere jüngeren Kollegen stöhnten jedes Mal
beim Anblick der schönen Beine!
Hier muss ich einwerfen, dass das Alter der asiatischen Menschen sehr
schwer einzuschätzen ist. Djin (z.B.) hielt ich für einen Fünfundzwanzigjährigen.
Im April 1989 war er in Deutschland und ich lud ihn mit zwei Professoren,
die mit zu der Delegation gehörten, nach Suhl ein, dabei stellte
sich heraus dass er genauso alt war und ist wie ich. Bei dieser Delegation
sagte einer der Professoren (Musikwissenschaftler) zu mir, dass er sich
an das Konzert in Taijuan (phonetisch hörte ich Yünnan) wo ich
dirigierte erinnere.