Kurt
W. Streubel (1921–2002)
Versuch einer Beschreibung
Vermittlung einer Vorstellung durch Angabe von Einzelheiten
"Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln,
dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben,
das man Möglichkeitssinn nennen kann.
Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen,
wird geschehen, muss geschehen; sondern er erfindet: Hier könnte,
sollte oder müsste geschehen; und wenn man ihm von irgend etwas erklärt,
dass es so sei, wie es sei, dann denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich
auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu
als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte,
zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht
ist".
Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften,
Verlag Volk und Welt, Berlin 1975, Bd. 1, Kapitel 4, S. 18
Robert Musil spricht von einem mit solcherart schöpferischen Anlagen
Versehenen als von einem „Möglichkeitsmenschen“ und davon,
dass ein solcher Mann keineswegs eine sehr eindeutige Angelegenheit sei.
Kurt W. Streubel verkörpert in meiner Erinnerung exemplarisch einen
solchen Möglichkeitsmenschen, und der Versuch, ihn zu beschreiben,
wird Eindeutiges nicht nennen können. Zu disparat, zu facettenreich
stellt er sich mir dar, zudem unberechenbar im Umgang mit Menschen. Dem
praktischen Leben gegenüber gleichgültig bis zur Spleenigkeit,
beging er Handlungen und bewegte in sich Gedanken, die ihm etwas anderes
bedeuteten als anderen.
Selten habe ich einen Menschen wie ihn erlebt. Er war wie ein Vulkan,
der gleichsam feuerspeiend, eruptiv seine Umgebung in ständiger Spannung
hielt und seine Mitwelt wie ein Lavastrom geradezu niederwalzte. Mit ihm
in der Diskussion oder in den fortwährenden stunden- und tagelangen,
oft auch nächtlichen Debatten, ergaben sich Szenen geistiger Anspannung,
skurriler Ideenfindungen, verrücktester Planungen, ernsthaften Hinterfragens,
aber auch Szenen eines ausufernden Humors.
Freunde lernen sich kennen und schätzen
Den Maler, Graphiker und Schrift-Steller Streubel, der aus dem multikulturellen
Böhmen stammt, lernte ich 1962/63 in Gotha kennen. Zu diesem Zeitpunkt
war ich als Dirigent im Staatlichen Sinfonieorchester Thüringen,
mit Sitz in Gotha, tätig. In diesem Orchester war Streubels Frau
Lia als Geigerin verpflichtet. Eine Begegnung mit Streubel ergab sich
fast folgerichtig.
Durch diese Begegnung begann zwischen Streubel und mir ein Verhältnis,
geprägt durch Missverständnisse, sprachliche zumal, über
Farbe und Ton, Form und Klang, Struktur und Komposition, aber auch die
Übereinstimmung auf eine wohl abgestimmte Disharmonie und die Akzeptanz
Gleichgesinnter.
Von Streubel selbst habe ich, nebenbei bemerkt, kaum jemals einen zu Ende
gesprochenen Satz gehört.
Er, der ständig, wie er selbst sagte, in 32 Potenzen - 32 eine literarische
Zahl - dachte, suchte nahezu sprunghaft sprachlich das Weite, wenn ihm
sein eigenes Denken zu eng wurde.
Von ihm wurden Sprache, Farbe, Form, Linie, Klang, Silbe, Buchstabe, alles
bis ins Detail seziert. Seine Sprach- und Wortfetzen, seine Typographien
sprechen unmissverständlich missverständlich alles und nichts
aus.
Von ihm, einem leidenschaftlichen Verfechter des Dadaismus, stammt der
Satz:
"Ehe DADA da war, war DADA da."
Als Beispiel seiner Sprachkomposition mag hier
"eine stunde m e d i t a t i o n in l- tag"
stehen, eine Art Lautgedicht: (kleiner Ausschnitt)
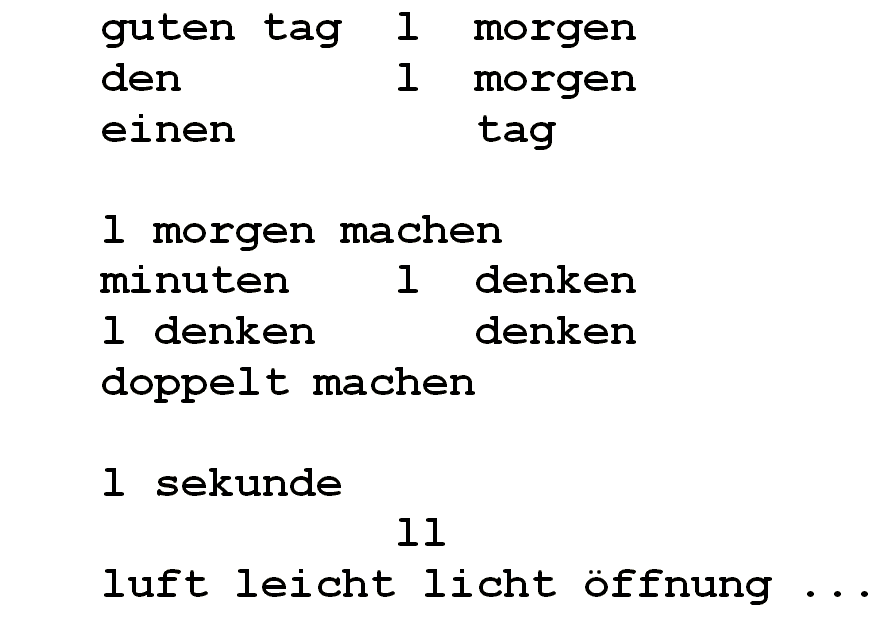
"Antioper“ - ein skurriler Gedanke und seine Entwicklung
Bei der gemeinsamen Arbeit an der Restaurierung unserer Wohnung 1967,
Am Bahnhof 3 in Suhl, fragte mich Streubel einmal:
"An was arbeitest du zur Zeit?"
Ich sagte zu ihm: "Eigentlich möchte ich eine Oper schreiben,
aber es ist schwer, ein Sujet oder ein Libretto zu finden. Ich möchte
keine Oper schreiben so wie am Bolschoi-Theater, oder bei Lortzing, wo
die Sänger ´rüber und nüber´ singen: Ich lieb
dich, du liebst mich, wir lieben uns…. usw."
Da meinte Streubel: "Ja, das kotzt mich genauso an!"
Dann sagte ich: "Ich dachte an James Joyce 'Ulysses', das letzte
Kapitel, in dem die Marion Bloom ohne Interpunktionszeichen, im Bett liegend,
ihr Leben, ihre Gedanken an sich vorüberziehen lässt. Dazu müsste
ein hervorragender Mezzosopran diese Rolle singen. Auf der Bühne
nur ein eisernes, altes Bettgestell und im Hintergrund einige Projizierungen.
Alles ganz nüchtern und sparsam."
Das gefiel ihm ganz gut. Wir redeten noch eine Weile über "Oper",
dann sagte ich plötzlich: "Eigentlich müsste man eine
'Antioper' schreiben."
Da spürte ich, wie bei ihm die "Neutronen" durch sein Gehirn
wirbelten.
Ende November 1970 kam er wieder einmal nach Suhl. Er knallte mir eine
Mappe auf den Tisch und sagte: "Schau dir das mal an!"
Ich schau in die Mappe, sehe Texte, Grafiken, ja sogar Regieanweisungen.
Die "Antioper" war geboren!
Nach einigem blättern in dem Material sagte ich zu ihm: "Ich
schau mir mal die Texte an. Wenn Texte dabei sind, die man in Musik umsetzen
kann, werde ich einige Songs schreiben."
So kam es auch, aber mit Schwierigkeiten: Jede Komposition mussten wir
beim Komponistenverband und bei der AWA (Anstalt zur Wahrung von Aufführungsrechten)
anmelden. Wie sollte ich diese Songs nennen? Die Texte waren zum Teil
politisch hochaktuell, aber auch brisant, wenn nicht sogar politisch missverständlich
und konnten falsch ausgelegt werden. Bei der Titelsuche zu den Songs kam
ich auf die Idee, sie „8 mehr oder weniger politische Songs “
zu nennen. Diese Songs sind im Verband weder hinterfragt - was üblich
war - noch vorgestellt oder diskutiert worden. Sie wurden einfach unter
den "Teppich gekehrt".
Einer der Songs sei hier präsentiert:
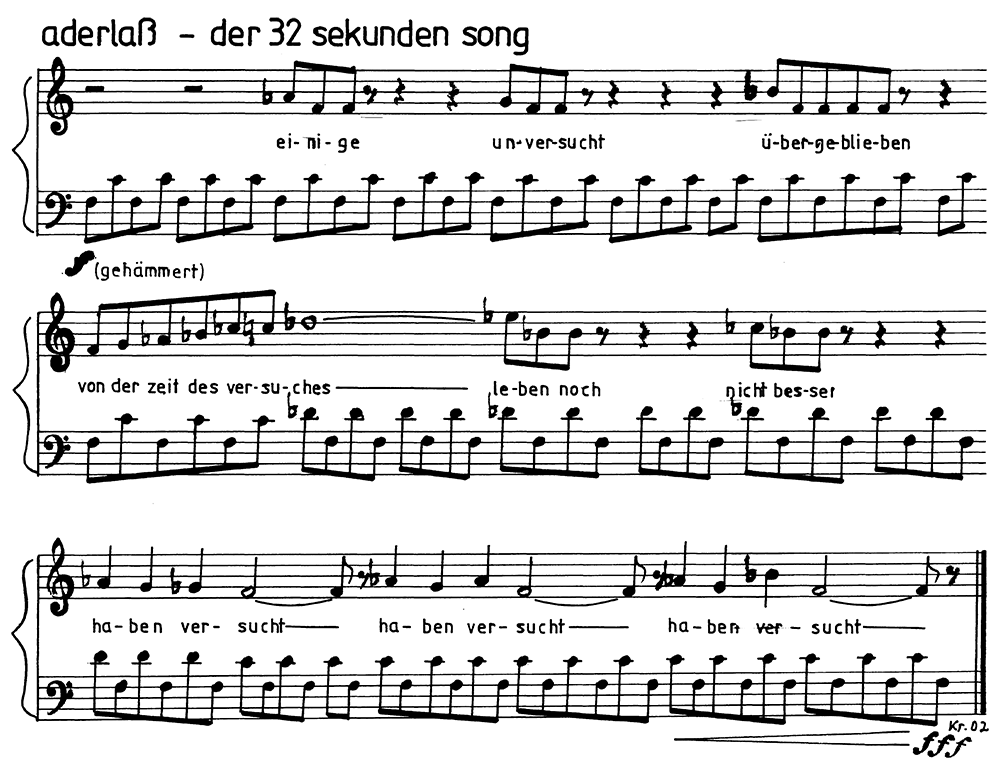
Streubels Freundschaft zu mir war allseits bekannt. Man befürchtete
in diesem Zusammenhang immer einen gesellschaftlichen oder politischen
Eklat.
Streubels frühe Lebensphase und Lebensentwicklung
Seine geistige Haltung und Einstellung, vom Bauhaus herkommend, zwang
ihn, sich nach kurzer Zeit von seinen Lehrern und einem Studium an der
Hochschule für Bildende Kunst zu trennen. Er verfolgte seinen ausgesprochen
individuellen Weg, um in die Kunst der visuellen Gestaltungsformen zu
gehen. Während der Zeit von 1947 – 49 müsste er Karl Meusel
(1912 – 1986) kennen gelernt haben. Am Boxberg bei Gotha unterhielten
die beiden ein gemeinsames Atelier. Aus dieser Zeit besitze ich eine Kohlezeichnung
"Thüringen – landschaftlich" (1949), welche vom Boxberg
aus gesehen einen wunderschönen Blick auf den Inselsberg darstellt
und Streubels abstraktes Empfinden für Form und Gestaltung vorwegnimmt.
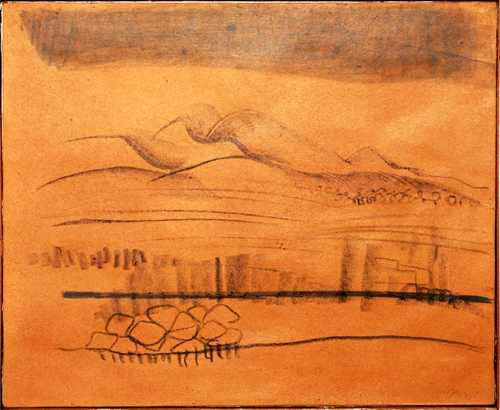
Thüringen (landschaftlich) 1949
(Blick zum Inselsberg)
Streubels Leben muss in seiner Jugendzeit, also nach dem Krieg, von einer
nicht zu beschreibenden Beweglichkeit und Dynamik durchsetzt gewesen sein,
verbunden mit persönlichen dramatischen Akzenten, aber auch mit einer
ganz eigenen Renitenz gegen alles und jedes. Von den vielen skurrilen
Begebenheiten aus dieser Zeit möchte ich hier nur seinen Auftritt
bei einer SED- Kreisparteikonferenz schildern:
Streubel, einer der ersten Genossen der SED in Gotha, nahm an dieser Parteikonferenz
teil. Nach kurzer Zeit reichte es ihm, wie die "Genossen" über
Marx, Lenin und den
Sozialismus "quatschten" (so Streubel zu mir). Er trat einfach
unaufgefordert an das Rednerpult und rief den verdutzten Genossen zu:
"Was quatscht ihr hier immer von Marx, Lenin und so..."“
Er rief ihnen lauthals zu:
" I c h b i n L e n i n !!! "
Sprach’s
- und verließ unmittelbar den Saal. Die Folge: sein sofortiger Ausschluss
aus der Partei.

Parteiversammlung / Schmutzige Wäsche 1951
Ausschluss aus dem Verband Bildender Künstler
Mit seiner 1949 entstandenen Pinselzeichnung "Kosmische Komposition",
die mit anderen neun Arbeiten 1950 in einer juryfreien Ausstellung in
Gotha gezeigt wurde, begann Streubels politisches, persönliches und
damit in gewisser Weise auch sein künstlerisches Fiasko. Wiewohl
diese Arbeiten ungemein wichtige und bedeutende Entwicklungsstufen in
seinem Schaffen markierten, ja geradezu exemplarisch Ausdruck seines künstlerischen
Wollens darstellten, dienten sie den Protagonisten jener unseligen Formalismus
- Realismus – Diskussion als Belege künstlerischen und politischen
Versagens. Die Folge war der Ausschluss aus dem Verband und damit eine
gesellschaftliche Isolierung. Keine Aufträge, zu keiner Ausstellung
mehr zugelassen, sozusagen "kaltgestellt", musste Streubel sich
durch das Leben schlagen.
In dieser Zeit, meine ich, entwickelte sich in der ehemaligen DDR das
so genannte "Orwellsche Zwiedenken". Orwells Roman, 1948 geschrieben
und "1984" betitelt, gilt als eines der bedeutendsten Bücher
über den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts. Die Künstler unseres
Landes arbeiteten damals einerseits für den angeordneten "Sozialistischen
Realismus", zum anderen – und nicht wenige - ausschließlich
für die eigene "Schublade".
Streubels Leben und Schaffen war hierfür ein signifikantes Beispiel.
Für ihn gab es keine Möglichkeit sich zu präsentieren,
sich bekannt zu machen, oder an Ausstellungen teilzunehmen. Er war mittellos
und finanziell abhängig von seiner Frau. Lediglich Gönner und
Freunde, die Arbeiten von ihm privat kauften, halfen über die prekärsten
Situationen hinweg.
Möglicherweise waren es aber auch oder gerade diese Umstände,
die Streubels Eigenständigkeit, seinen Eigensinn und seine künstlerische
Eigen-Art prägten. Die Folge der Vorgänge um jene juryfreie
Ausstellung war, wie gesagt, der Ausschluss aus dem Künstlerverband.
Erst 1979 kam Streubels Wiederaufnahme zustande, bewirkt durch Appelle
einiger Zeitgenossen.
Zusammenarbeit mit der Suhler Philharmonie
Während meiner Tätigkeit beim Staatlichen Sinfonieorchester
Suhl kam es zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Alle Drucksachen: wie
Plakate, Programmhefte, persönliche Prospekte, Druck- bzw. Gestaltungseffekte,
die ich benötigte, gestaltete Streubel. Dabei legte er meist drei
gültige Entwürfe vor, die wir natürlich aus Kostengründen
alle verwenden konnten und mussten, einfach weil sie immer alle gut waren.
Er gestaltete auch die von mir in Hildburghausen und Suhl eingeführten
Orchesterbälle (Faschingsbälle) mit Dekorationen, welche aus
dem allgemein gewohnten und gebräuchlichen Rahmen heraus fielen.
Anlässlich eines Orchesterballes - ich meine es war 1968 - wurden
einige dieser Dekorationen mit vermeintlich politisch brisanten Dekors
von „Kreisleitungsgenossen“ hinter unserem Rücken abgehängt.
Dies rief unsererseits Proteste hervor und wurde dementsprechend beantwortet.
Wir - Streubel, die Solisten des Abends und ich - verließen nach
dem üblichen Programmteil ostentativ den Saal. Wir demonstrierten
damit gegen die Unverfrorenheit und Unverschämtheit der Partei und
deren Eingriff in das persönliche Ideen- und Urheberrecht. Wahrscheinlich
hatte schon das Plakat für diesen Orchesterball Anlass für "erhöhte
Wachsamkeit" gegeben. Aus einer "Weinlaune" heraus hatten
wir uns den Plakattitel und das Motto erdacht, es lautete: "egum
tararara dudum".
Ein Plakat unter diesem Motto, 1968 in der DDR?
1969 komponierte ich, gemeinsam mit Hans-Jürgen Thiers, das Oratorium
"Der Mensch", nach Texten des litauischen Dichters Eduardas
Miezelaitis. Hierzu schuf Streubel ein graphisch gestaltetes Titelblatt.
Dieses drucken zu lassen, wurde seitens staatlicher Behörden (Rat
des Bezirkes und der Partei) regelrecht verboten. Innerhalb meiner mir
selbst angemaßten Befugnisse ließ ich 100 Stück illegal
herstellen. Sie sind noch heute ein einmaliges Dokument und beweisen,
dass man auf die ein- oder andere Art und Weise das staatliche Reglement
umgehen konnte.
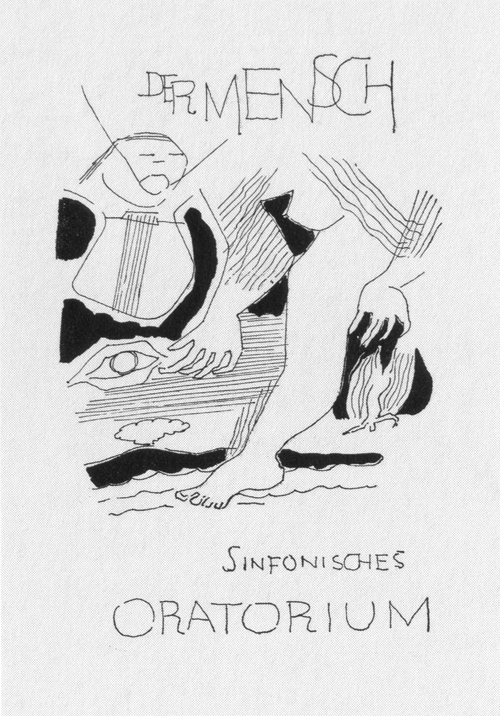
Vom Rat des Bezirkes Suhl nicht genehmigte
Graphik für das Programmheft "Der Mensch" 1969
Private Kunstausstellung in unserer Wohnung
Ein besonderer Höhepunkt in unseren Beziehungen war die im Mai 1976
von Streubel und mir inszenierte Privatkunstausstellung in unserer Wohnung
in Suhl. Diese Wohnung hatte ich von 1967 bis 1968 gemeinsam mit Streubel
renoviert bzw. restauriert und gestaltet. Streubels Hauptanteil war die
farbliche und raumgestalterische Ausrichtung. Durch die künstlerische
Farbgestaltung, aber auch durch das eigens hergestellte Mobiliar wurde
diese Wohnung nicht nur ein angenehmer Lebens-Raum, sondern eine angemessene
Begegnungsstätte. Die bei uns verkehrenden Künstler, national
und international - ich lud sie grundsätzlich immer auch privat ein
- waren begeistert von Streubels Geschmack, Farbnuancierungen und der
räumlichen Aufteilung. Der Abend hatte zwei Schwerpunkte, die von
uns und unserem Helfer, Siegfried Seiffert (Altenburg), geplant und besonders
ausgeklügelt waren.
An diesem Abend dirigierte ich eines der traditionellen Suhler Sinfoniekonzerte.
Auf dem Programm standen Mozarts „Pariser“ Sinfonie, KV 297,
das Violinkonzert von Alban Berg, mit dem hervorragenden Solisten Manfred
Scherzer (Berlin/Dresden) und eine Uraufführung meines tschechischen
Komponistenfreundes Stepan Lucky: "Konzert für Orchester".
Zu Stepan Lucky muss gesagt werden: Die Nazis verhafteten ihn 1940 in
Prag und verschleppten ihn nach Buchenwald in das Konzentrationslager.
Er überlebte den Todesmarsch nach Worbis in das Außenlager
"Mittelbau Dora".
Für uns war er nach dem Krieg und nach dem "Prager Frühling"
1968, trotz der Aversion gegen Deutsche, ein liebenswerter, zuverlässiger
und treuer Freund. Diese Freundschaft hatte eine besondere Bedeutung,
vor allem für mich, da ich einige seiner Kompositionen in Suhl aufführen
konnte, vor allem sein erschütterndes Violinkonzert, welches er in
Erinnerung an die erlittenen Qualen in Buchenwald komponiert hatte. Dieses
Konzert beginnt mit einem Glockengeläut. Auf meine Frage, wieso er
das Konzert mit einem Geläut an den Anfang stelle, sagte er zu mir,
dass er, als er in Buchenwald war hörte er manchmal abends aus der
Ferne Dorfglocken läuten gehört habe, dies hätte ihn an
seine Heimat erinnert, und aus diesem Grund wolle er das in die Komposition
einfließen lassen.
Zu dem Konzert und der Ausstellung hatten wir über 200 Einladungen
in alle Welt verschickt. Vom ZK der SED, über das Ministerium für
Kultur, den Kulturbund, die "örtlichen Organe", luden wir
alles ein, was Rang und Namen hatte. Privat natürlich auch uns vertraute
und bekannte Freunde und Persönlichkeiten. Nach der Popularisierung
der Einladungen klingelten die Telefone zwischen Berlin und Suhl: Wer
ist Streubel, wer Geißler, und wieso eine private Kunstausstellung
in Suhl? Nach damaligen Gesetzen waren solcherart Veranstaltungen quasi
generell verboten und untersagt. Sie kamen dem Versammlungsverbot nahe,
und es stellte sich die Frage nach den staatlichen Genehmigungen. Zu dieser
Werkausstellung waren dann schätzungsweise 70 Personen anwesend.
Der einzige Offizielle, welcher offensichtlich im Auftrag der Bezirksleitung
der "SED" gekommen war, war der damalige Kultursekretär
Dr. Anschütz. Alle anderen "Funktionäre" besuchten
zwar das Konzert, mieden aber diese private Veranstaltung, sicher aus
Angst vor politischen Auseinandersetzungen und möglichen Repressalien.
Die Laudatio auf Streubel hielt der renommierte Naturwissenschaftler Prof.
Dr. mult. Joachim-Hermann Scharf, seines Zeichens: Director Ephemeridum
der Akademie der Naturforscher "Leopoldina" Halle. Zum Thema
und Tenor seiner Laudatio hatte er sich Streubels 1971 entstandenes Ölgemälde
"Die Zeit" gewählt. Interessant und aufschlussreich war
es damals für uns, wie unsere Besucher reagierten und wie ein Naturwissenschaftler
moderne, abstrakte Kunst aus seiner Sicht betrachtete, sie interpretierte,
mit ihr sprachlich umging und diese in sein naturwissenschaftliches Denken
einbezog. Der gesamte Abend - das Konzert zum einen und die Ausstellung
zum anderen - stellte nicht nur ein besonderes Ereignis dar, sondern war
für Suhl und für die DDR gleichsam eine Sensation.
Zusammenleben in Suhl mit Streubel
Die Jahre unseres "Zusammenlebens" waren bis zum Rand gefüllt
mit Bonmots, merkwürdigen Sentenzen, Eskapaden, sonderbaren Begebenheiten
und Ereignissen. Vom Frühstück angefangen über die Arbeit
hinweg bis in die Abendstunden, - die häufig über das Normale
hinausgingen und nicht nur die Familie, sondern andere Anwesende strapazierten,
aber auch zum Lachen brachten.
Streubels Begrüßungsspruch, wenn er zu uns kam, war das skurrile,
dadaistische "Nombo Tombake".
Einmal kam er und sagte zu meiner Frau: "Heute werde ich mal
nicht so viel reden, ich habe noch Herzschmerzen vom letzten Besuch bei
euch. Wo ist Siegfried?" Streubel kam dann zu mir, zündete
sich nach dem "Nombo Tombake" eine Zigarette an und sprach geschlagene
12 Stunden ununterbrochen zu mir. Ich hatte kaum eine Chance dazwischenzureden,
mir gelang es, gerade mal drei bis vier Sätze einzustreuen. Dabei
überstürzten und überschlugen sich seine Gedanken und seine
Lebensgeschichten, so dass ich am Ende, ein wenig erschöpft, sein
Leben fast besser kannte als er selbst. Man musste bei ihm Geduld aufbringen.
Skurrilitäten eines außerordentlichen Künstlers
Die Art seiner Situationskomik, die bei den Begegnungen mit ihm immer
zu erwarten war, lässt sich heute kaum mehr schildern. Man musste
ihrer stets gewärtig sein, und sie lässt sich nur im Zusammenhang
wiedergeben.
Einmal saßen er, unser Sohn Moreen und ich in Gotha zusammen beim
Mittagessen im vollbesetzten Ratskeller. Streubel fragte unseren damals
12- bis 13-Jährigen: "Na, was macht die Schule?"
Daraufhin Moreen unter anderem: "Wir mussten einen Aufsatz schreiben
über die Angst. Ich wusste aber nicht, was ich schreiben sollte."
Streubel daraufhin laut wie immer: "Da hätt´ste halt
geschrieb´n: Ich hab´ Angst vor d´n Russen."
Um uns herum war sozusagen "Funkstille".
Mit solchen und anderen Skurrilitäten könnte man Bände
füllen.
Die DDR bezeichnete er einmal als "Katzenmörderstaat"!
Ich fragte ihn, warum?
Seine Katze war tot. Er sagte zu mir:
"Stell dir mal vor, da stelln´se e´ Gerüst vor
dein Haus. Da steht´s dann e´ halbes oder Dreivierteljahr.
Gemacht wird nischt, aber die Katzen gewöhnen sich dran, im 2. Stock
aus dem Fenster aufs Brett zu springen. Eines Tages ist das Gerüst
weg! - Die Katzen hatten sich aber ans springen gewöhnt..."
Streubel sprach einen ganz eigenartigen Dialekt, welcher sich leicht böhmisch
verbrämt anhörte. Sprachlich ein völlig vermurkster Stil,
aber amüsant und köstlich anzuhören. Bei unseren gemeinsamen
Restaurierungsarbeiten in unserer Wohnung – so ich Zeit hatte, ihm
zu helfen – die immer bis in die späten Abendstunden dauerten
- sagte er oft aus Spaß: "Ich liebe die Sonne sehr, aber
nur nachts!"
Da wusste ich, aha, er möchte gern noch einen Kognak trinken. Also
zogen wir los in die Thüringen-Tourist-Bar, die ca. 250- bis 300m
von unserer Wohnung entfernt lag. Er trank gern französischen Kognak,
rauchte dazu eine Orientzigarette, mit dem Goldrand als Mundstück.
Ihm beim Rauchen zuzusehen war amüsant. Er streifte nie die Asche
ab, sondern ließ sie solange an der Zigarette, bis die Asche entweder
auf die Tischdecke – dann gab es immer eine „Brandloch“
– oder zu Boden fiel. Die letzte Kippe schob er von einem Mundwinkel
zum anderen, bis zum letzten Zug. Bei einem dieser Barbesuche sagte er
einmal zu mir: "Man müsste eigentlich eine Todesbar einrichten."
Daraufhin fragte ich ihn: "Wie stellst du dir das vor?"
Kurt sagte: "Du kommst in die Bar, kannst trinken, rauchen und
huren, soviel du willst. Nur heraus kommst du nicht mehr. Niemals mehr!
Du musst bis an dein Ende drin bleiben."
Ein skurriler Gedanke, amüsant und exzentrisch. Bei solchen Gedanken
wehte ein Hauch des "sich Totlebens" mit, vielleicht auch –
trotz seiner ungebrochenen Lebenslust – eine gewisse Müdigkeit
eines ständig schöpferisch tätigen, vergeistigten Menschen.
Fragen der Kunst und der Wissenschaft
Die Frage, wie Kunst bewertet und betrachtet wird, und deren Verhältnis
zur Wissenschaft, war ein ständiger Diskussionsgegenstand zwischen
Streubel und mir. In vielen Gesprächen formulierten wir letztendlich
– ich muss es hier auf eine Kurzform bringen -, dass Kunst und Wissenschaft
grundsätzlich begrifflich und formal getrennt werden müssen:
Der Wissenschaftler kann nur die vorhandenen Gesetze erkennen,
erforschen und interpretieren. Der Künstler hingegen schafft sich
mit seinen Werken und durch diese seine eigenen Gesetze, und - nur die
Kunst kennt die Ekstase.
Die Abstraktion in der Kunst ist eine der vielschichtigsten und vielseitigsten
Gliederungen des Denkens, darüber gibt es nichts anderes.
Bei allen Diskussionen, die wir mit Freunden und Künstlern hatten,
forderte diese einfache Formel Widerspruch heraus. Sie stiftete Verwirrung,
fand aber auch vielerlei Zustimmung. Nicht zuletzt half mir die Erinnerung
daran, später, in der Zeit nach der „Friedlichen Revolution“,
während meiner politischen Tätigkeit im NEUEN FORUM und als
Abgeordneter im Verfassungsausschuss des Thüringer Landtages, diese
Positionen zu verteidigen und sie umzusetzen. Ihren Niederschlag fand
sie in der Thüringer Verfassung insofern, als ich im Disput um Artikel
27 durchsetzen konnte, dass Wissenschaft und Kunst bewusst getrennt werden
müssen. Diesbezüglich hat die Thüringer Verfassung als
einzige in Deutschland keinerlei definitorische Einschränkung. Es
heißt in Art. 27 (Satz 1) explizite:
"Kunst ist frei. Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei …"
usw.
Ein wichtiger gesellschaftspolitischer Aspekt und für die Künstler
ein nicht zu unterschätzender gewonnener Freiraum.
Beginn der Nach-Streubelschen Zeit
Mit meinem Ausscheiden 1980 als Chefdirigent der Suhler Philharmonie änderte
sich zunächst nichts in meinem Verhältnis zu Streubel. Durch
die Aufgabe meiner Position hatten wir zwar weniger beruflich miteinander
zu tun, unser freundschaftliches Verhältnis bestand aber weiterhin.
Für das Orchester selbst und dessen neue Leitung war dies etwas anderes.
Sie hatten zu Streubel und seinen Arbeiten immer schon ein gespaltenes
Verhältnis, so dass eine Entfremdung nicht ausbleiben konnte. Mein
Nachfolger, Claus-Peter Flor, ein hochbegabter junger Dirigent, welchen
ich zu meiner Zeit besonders förderte, brachte es 1981 zustande,
dass meine 6. Sinfonie (Farb-Klang-Realismen), welche ich Kurt-W. Streubel
gewidmet hatte, in Suhl aufgeführt wurde. Diese Uraufführung
war noch einmal ein wichtiger Anlass für unsere freundschaftliche
Beziehung. Streubel überreichte mir am Schluss des Konzertes ostentativ
in aller Öffentlichkeit seine mit "Ankunft" betitelte Grafik
und brachte damit unsere Verbundenheit zum Ausdruck.
Eine der wenigen Gelegenheiten, mit Streubel in der Öffentlichkeit
aufzutreten, war der "Heinrichser Hofsommer". Als Mitinitiator
desselben, welchen wir ab dem berühmten Orwell-Jahr 1984 gemeinsam
mit einer jungen Suhler Künstlergruppe durchführten, befasste
ich mich u.a. mit elektronischer Musik und mit Laser-Licht-Effekten. Dieser
alljährlich stattfindende „Heinrichser Hofsommer“ war
als Gegenausstellung zu den "Kunstausstellungen" des Bezirkes
Suhl gedacht und provozierend, damit auch protestierend, von dieser Gruppe
inszeniert worden. Zu diesen stets gut besuchten „Hofsommern“
hatten junge Künstler die Möglichkeit, Werke zu zeigen, die
in den "offiziellen" Ausstellungen vom Verband und den Staatsorganen
nicht angenommen worden waren.
Zu solch einer Ausstellung konnte ich Streubel bewegen, noch einmal nach
Suhl zu kommen, um an den Diskussionen teilzunehmen.
Danach kühlte sich unser Verhältnis mehr und mehr ab.
Zeitgründe und politisches Engagement meinerseits, meine Tätigkeit
im Bürgerkomitee des Landes Thüringen bei der "Stasiauflösung"
und im bereits erwähnten NEUEN FORUM dessen Spitzenkandidat ich 1990
war, ergaben den Anlass hierfür. Meine politische Tätigkeit
im ersten frei gewählten Thüringer Landtag als Abgeordneter
und erster Alterspräsident hinderte mich daran, unser altes Verhältnis
aufrechtzuerhalten.
Neue Demokratie und eine unvollendete, friedliche Revolution
Für mich, der ich bereits nach 1945 ebenso wie Streubel an eine wahrhafte
Erneuerung der Demokratie in Deutschland glaubte und enttäuscht wurde,
verband sich mit der politischen Umwälzung 1989 die Hoffnung, dass
nunmehr eine politische Renaissance 1990 gelingen möge. Zu dieser
Zeit hätte ich mir den nach wie vor in Gotha lebenden Streubel als
Gegenpol zu allem sich Vollziehenden, als ausgesprochenen "Antipoden",
sehr in meiner Nähe gewünscht. Mit seiner Fähigkeit der
kritischen Provokation und dieser Lust am ungezähmten, realistischen
Bezeichnen der Dinge wäre er ein
dynamisch konstruktiver Partner gewesen. Leider war dem nicht so. Er zog
sich, wider jede Erwartung, mehr und mehr zurück.
Wir, die wir hier im ehemaligen Bezirk Suhl lebten spürten mehr die
Macht des SED-Apparates und der Stasi durch den Grenzbezirk. Überwachungs-
und Kontrollsysteme für den gesamten westlichen Luftraum, vom Ellenbogenberg
bei Frankenheim, über die Gleichberge bei Römhild bis nach Steinheid
war alles unter Kontrolle. Dazu das Spionagezentrum zwischen Römhild
und der Staatsgrenze. Außerdem die Zwangsaussiedlung entlang der
Thüringer Grenze, all dies – für die Bevölkerung
nicht bekannt – wurde zum Pulverfass, als die „friedliche
Revolution im Oktober 1989 begann. In Suhl fand am 4. November eine erste
große Demonstration, mit ca. 30 000 Menschen statt. Der Höhepunkt
war dann die Erstürmung der sog. "Stasiburg" am 4. Dezember
1989. Der südwestlichste Teil der DDR hatte in seiner militanten
Ausrichtung und Auswirkung eine besonders hohe Brisanz für die vermeintliche
Sicherheit des Staates.
Umso mehr wünschte ich mir zu dieser Zeit Partner, die sich noch
intensiver und aktiver mit einbezogen hätten in eine Bewegung, die
wir kaum mehr ein zweites Mal erleben werden..
Trotzdem bin ich stolz darauf, dieses "Multiversum" Kurt W.
Streubel kennen gelernt, mit ihm aufregende und erregende Jahre verbracht
zu haben. Sie waren gleichermaßen vom Denken und vom Tun her revolutionär
in dem Sinne, dass sie den "Staat" in einer Weise beschäftigten
den er sich so nicht vorstellte und der auch nicht erwünscht war,
weil er unter die Kategorie "Konterrevolution" eingestuft wurde.
Eine letzte Begegnung fand am 6. Oktober 2002 anlässlich der Kunstausstellung
meiner Privatsammlung in der Comptoire-Galerie in Sonneberg statt.

Streubel / Geißler "Letzte Begegnung
am 6. Oktober 2002
anläßlich der Kunstausstellung in der Comptoire-Galerie Sonneberg"
Kurz darauf, am 8. Dezember 2002, verstarb Streubel in Weimar in der Seebach-Stiftung,
die ausschließlich alternden Künstlern zugedacht war.
Die vielfältigen Ereignisse und Erlebnisse, vor allem mit und durch
Streubel, die sich parallel immer als provokant herauskristallisierten,
sei es im Leben, in der Kunst oder in der Politik, gaben meinem Leben,
das ausschließlich von der Kunst geprägt war, einen besonderen
Impetus.
All dies vor dem Hintergrund der eigenen künstlerischen Arbeit, des
eigenen Schaffens, den politisch wahrzunehmenden Aktualitäten des
Alltages, der Verantwortung für die Familie und der Verantwortung
für einen Kultur- und Kunstbetrieb.
(Bilder
u. Inhalte, mit freundlicher Genehmigung des Comptoir-Kunstmagazin, Städtische
Galerie Sonneberg, Frau Reinhild Schneider)